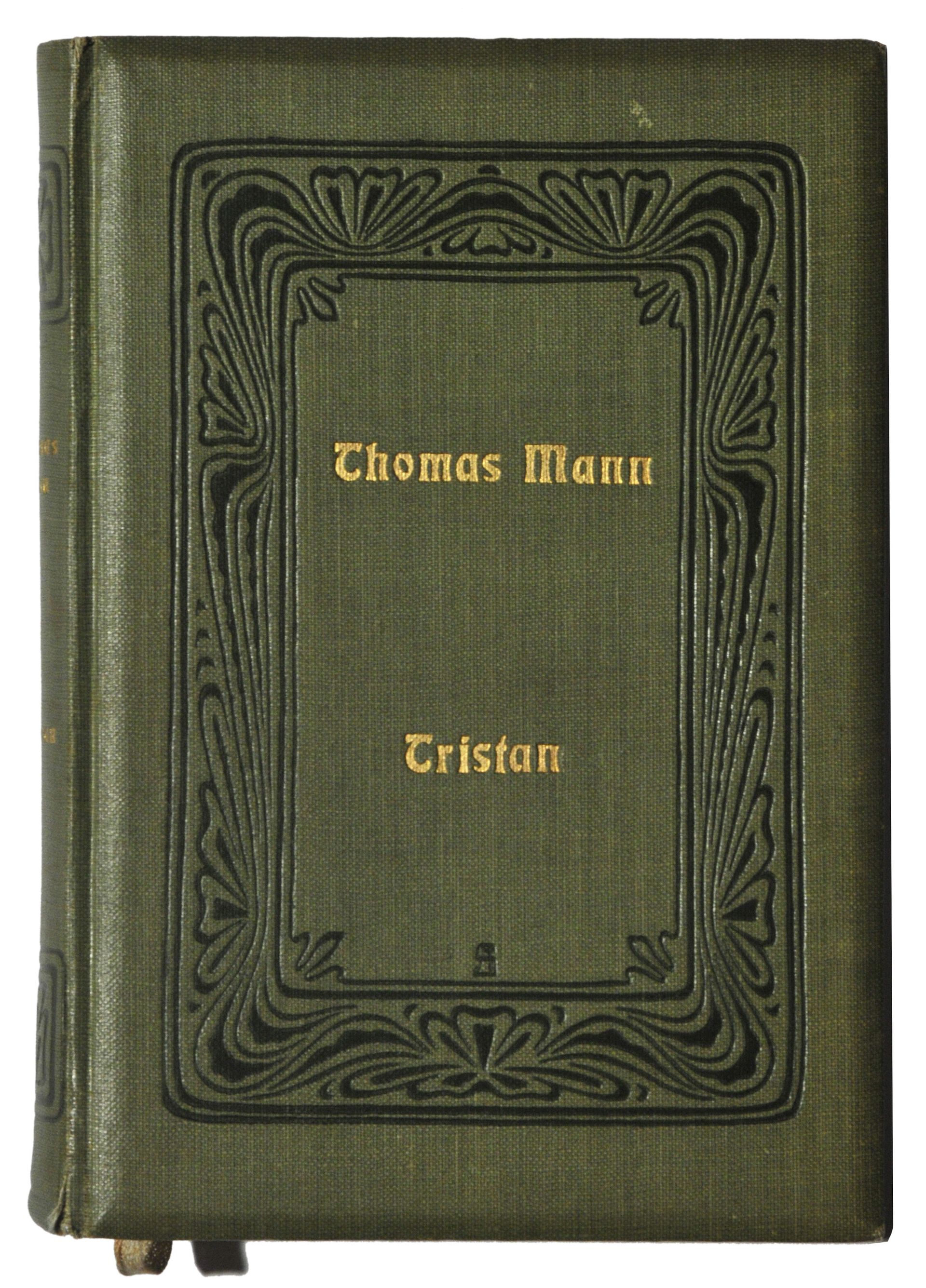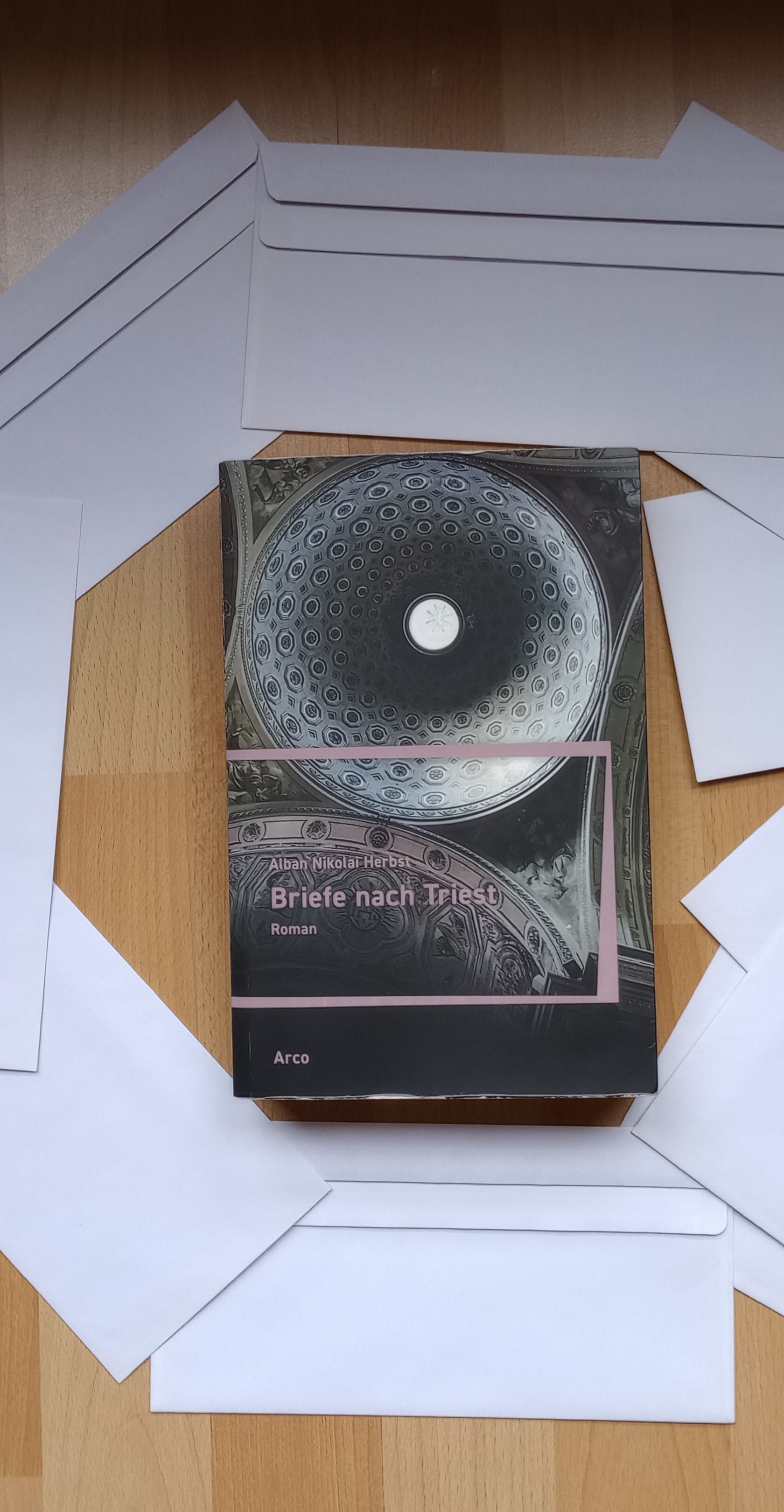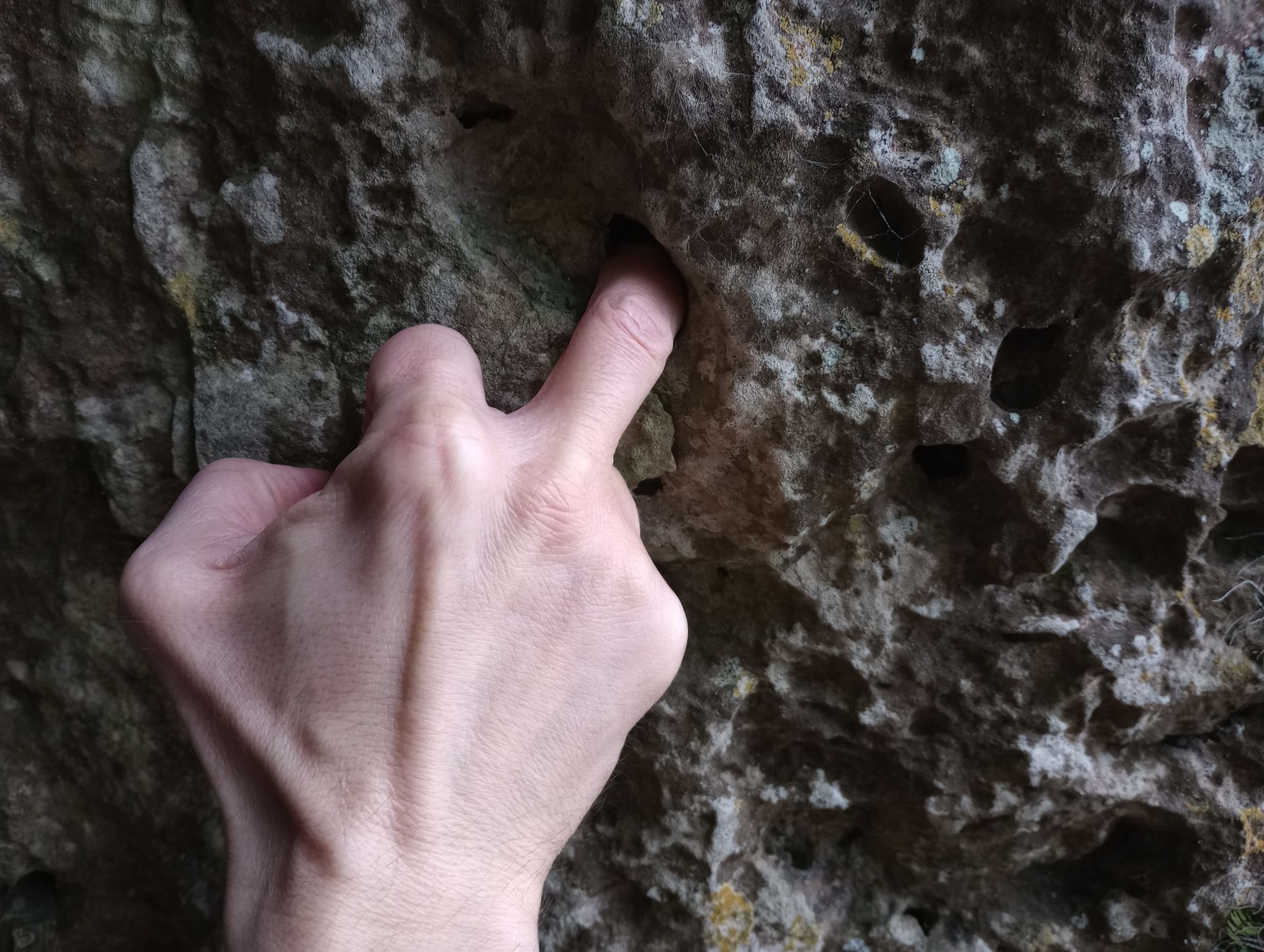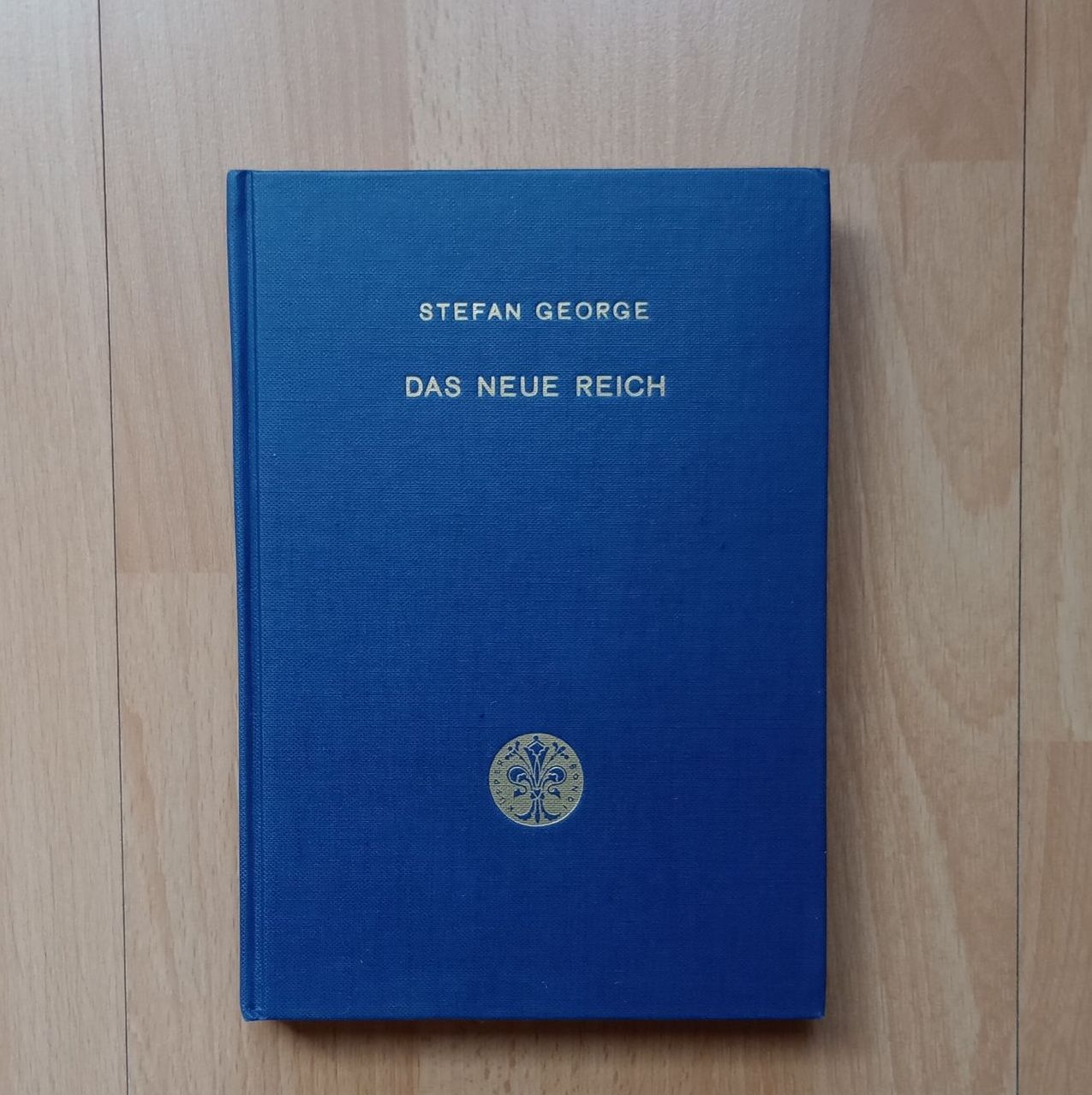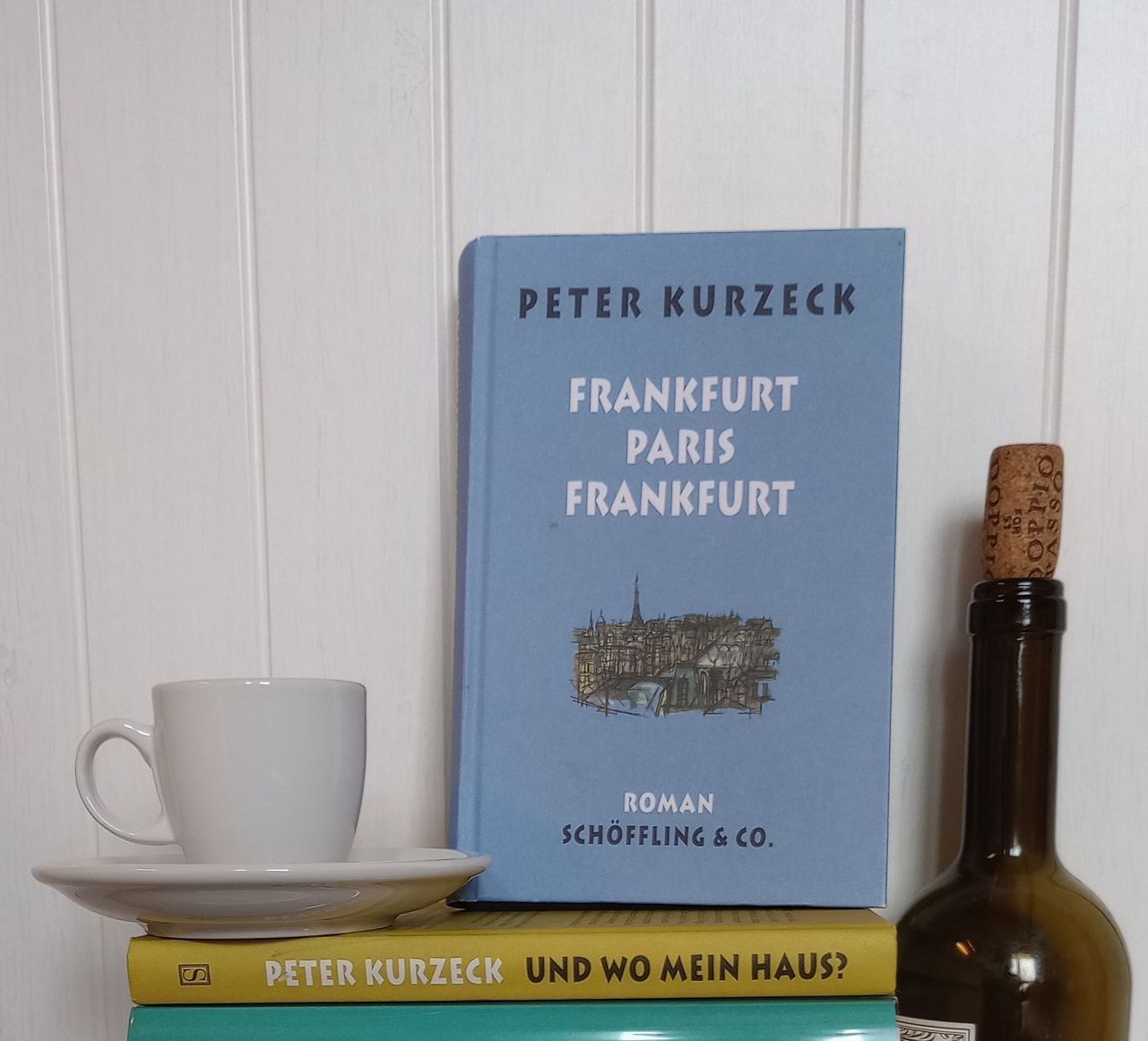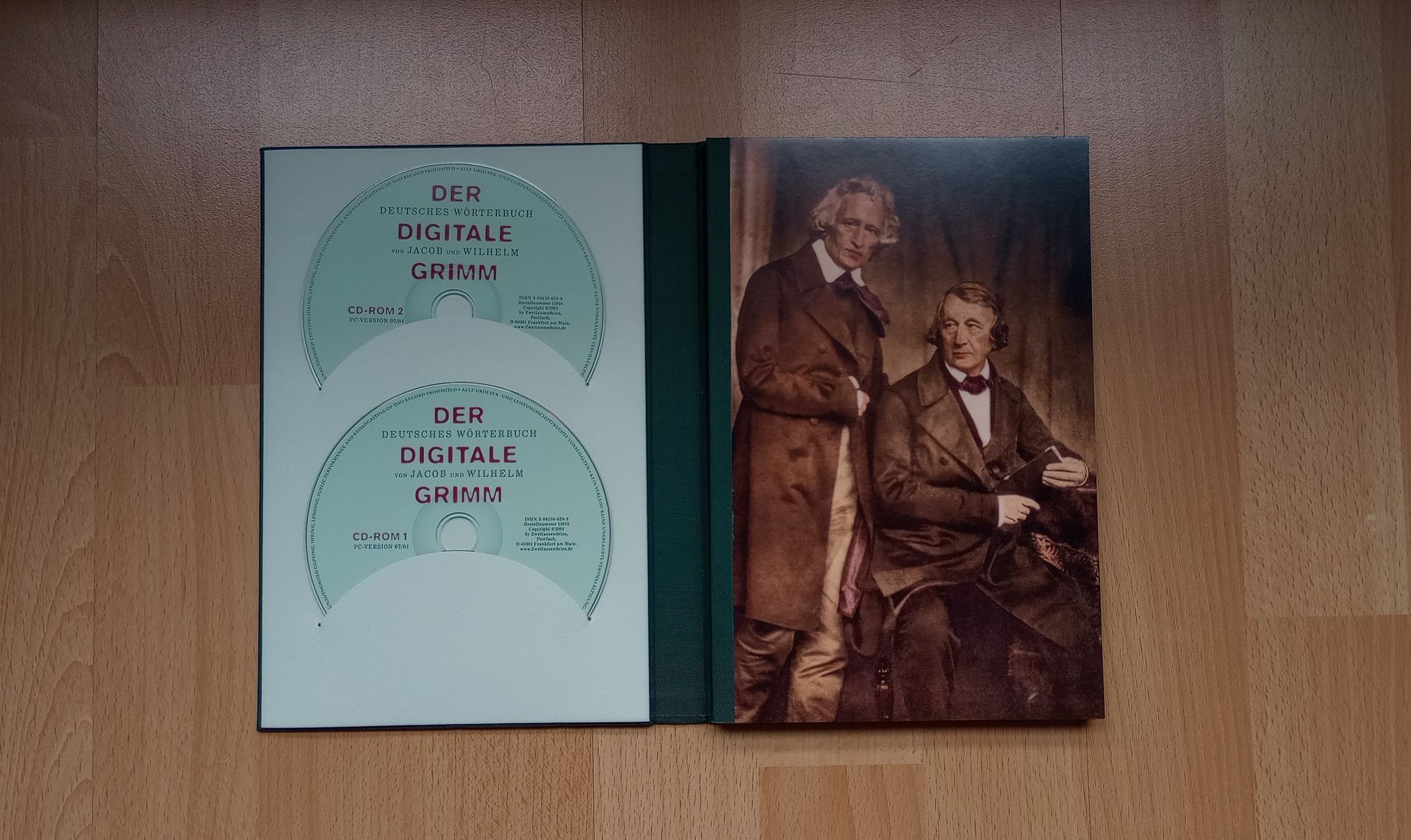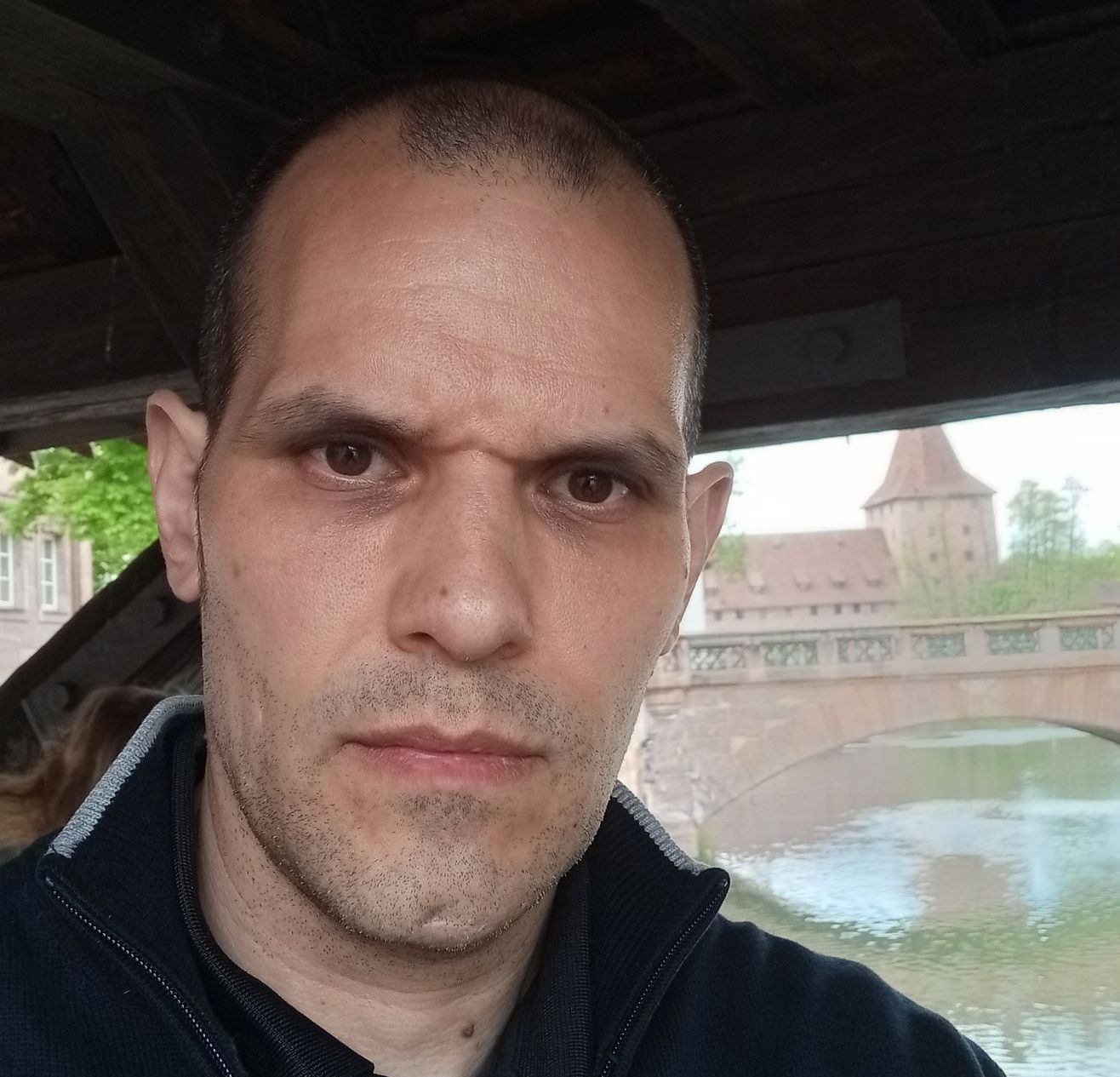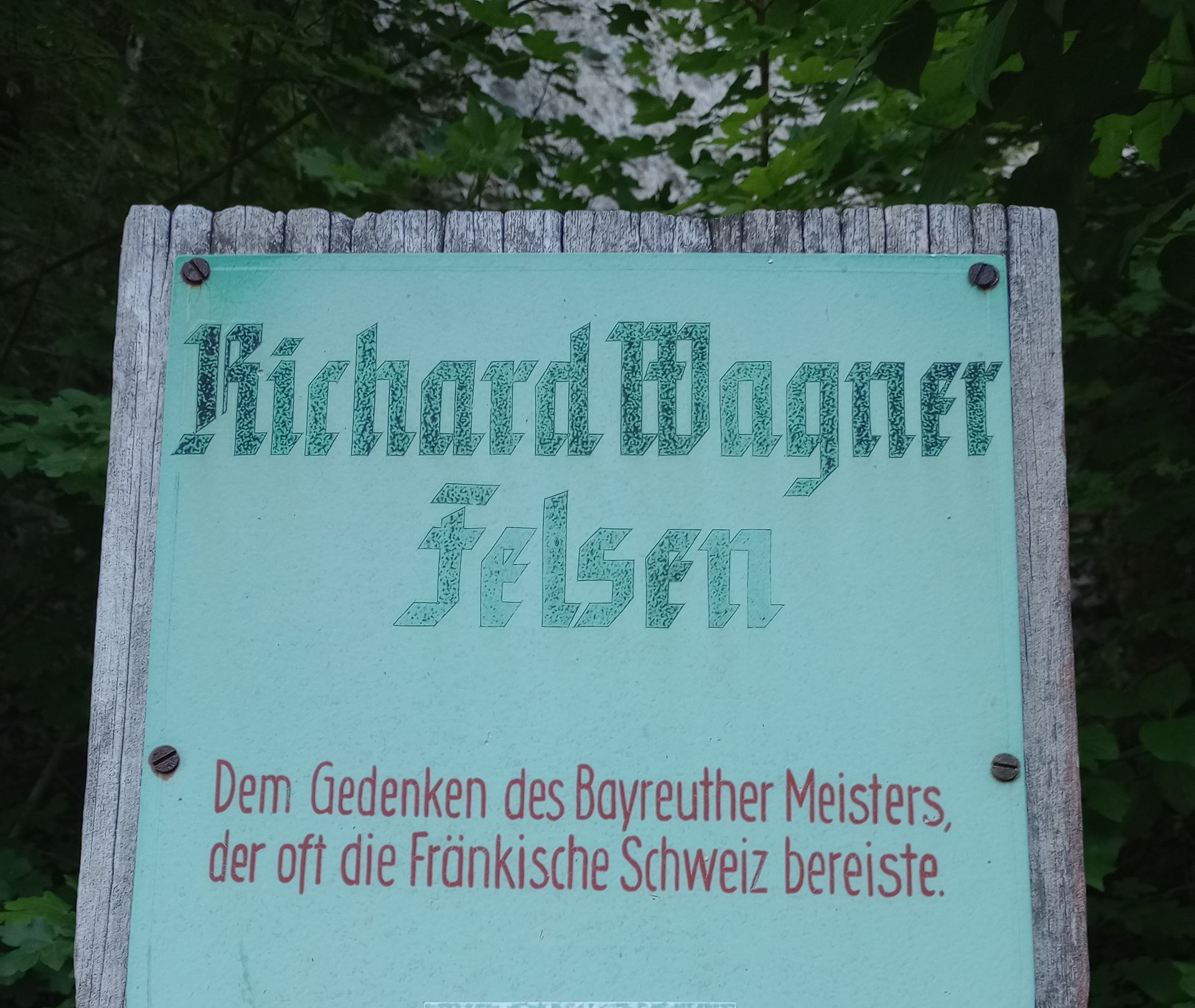"Die Ärzte"

Die Achtziger
Meinen ersten „Die Ärzte“-Song habe ich im Winter 1988 auf einer Party gehört und ich vermute, dass ich bereits 87 oder sogar schon 86 wusste, dass es diese Band gibt. Als westdeutscher Jugendlicher kam man in den Achtzigern an „Die Ärzte“ kaum vorbei. (Die Band selbst fasst den Artikel als undeklinierbaren Teil des Namens auf. Da hierdurch aber häufig schwer lesbare Konstruktionen entstehen, werde ich „Die Ärzte“ im Weiteren (grammatisch) wie eine Berufsbezeichnung behandeln – die Bandmitglieder mögen es mir vergeben.)
Mein Roman
Trotzdem war nicht unbedingt vorhersehbar, dass ich im August 2024, mittlerweile im 51. Lebensjahr, ein Ärzte-Konzert besuchen würde. Dass dies dennoch geschah, hat auch, aber nicht nur, mit meinem aktuellen Projekt zu tun.
Als ich 2021 mit Vorarbeiten dazu begann, gerade war nach langer Zeit ein neues Ärzte-Album erschienen, kam mir der Gedanke, den Stoff – zwei junge Männer versuchen um die Jahrtausendwende das zu tun, was sie sich unter „aussteigen“ vorstellen – in einen losen Bezug zu Ärzte-Songs zu setzen, ohne dies aber ins Zentrum des Buches zu rücken, sondern eher im Sinne eines „Soundtracks“ oder Running Gags. Dadurch entdeckte ich die Band noch einmal neu.
Mehr als "Westerland"
Die Ärzte polarisieren. Sie haben diesem Phänomen sogar ein Lied gewidmet („Ein Lied für dich“). Ich persönlich verorte mich zwar eindeutig auf der Pro-Seite, kann jedoch mehr anfangen mit dem, was ich Kuriositäten nennen würde, als mit Hits wie „Westerland“. Zu den herzerfrischenden Merkwürdigkeiten rechne ich etwa: „E.V.J.M.F.“, „Deine Freundin (wäre mir zu anstrengend)“, „Der Afro von Paul Breitner“, „Schopenhauer“, „Nazareth“ oder „Die Einsamkeit des Würstchens“.
Generell finde ich den Hinweis wichtig, dass die Band viel mehr ist als die drei, vier Stücke, die gelegentlich im Radio gespielt werden. Ihr Oeuvre umfasst ganz unterschiedliche Text- und Musikstile. Die Zuordnung zum Punkrock ist im Grunde fraglich, wenn man das Gesamtwerk betrachtet. Die Verschiedenartigkeit mag unter anderem mit der langen Bandgeschichte (42 Jahre!) sowie damit zu tun haben, dass alle drei „Ärzte“ Songwriter sind.
Was ließe sich sonst noch zur selbsternannten „besten Band der Welt“ sagen? Vielleicht, dass sie von kaum einer deutschsprachigen Gruppe an Wortwitz und ulkigen Ideen übertroffen wird. Genial allein der Einfall, ein ganzes Album verschiedenen Haar- und Barttrachten zu widmen („Le Frisur“, 1996). Und „irgendwie mein Herz gewonnen“ („Ein Lied für dich“) haben die Ärzte mit Zeilen wie: „Unser Streben nach Schönheit und Perfektion / Führt uns wieder zurück ans Mikrofon / Führt uns wieder zurück ins Rampenlicht / Aber eigentlich brauchen wir die Lampen nicht / Denn wir leuchten im Dunkeln, wir blitzen und funkeln / Das war ein Hendiadyoin / Das wird die Germanisten freuen“, mit Reimen wie: Coolnessfaktor/Gartentraktor oder Fleischermeister/Zugereister (letzterer stammt genau genommen von einem Soloalbum des Gitarristen Farin Urlaub).
Die Ärzte live
Doch zurück zu dem Konzert – eines von drei, die an aufeinanderfolgenden Tagen auf dem Tempelhofer Feld stattfanden, dem riesigen Gelände des ehemaligen Flughafens Berlin Tempelhof.
Die Ärzte gehören zu den Bands, die live besonders gut sind. Die Songs werden schneller gespielt, die Texte spontan variiert und hinzukommen die Dialoge von Farin Urlaub und Bela B, die eine Art eigenes Comedy-Genre sind: Im Kern ein heiteres Geplänkel, das nicht unter dem Diktat permanenten Witzig-Seins steht und so oder ähnlich auch hinter der Bühne stattfinden mag. All dies ist für Kenner der Band allerdings nichts Überraschendes. Erstaunlich wenigstens für mich war indes die Diversität des Publikums (bei YouTube bekommt man die Zuhörer ja eher selten zu Gesicht oder achtet nicht auf sie): Auf dem Tempelhofer Feld sah ich Menschen zwischen fünf und siebzig, sowohl den einen oder anderen Alt-Punk als auch ganze Familien mit „Die Ärzte“-T-Shirts. Das ist bemerkenswert und lustig, da die Band in den Achtzigern ausschließlich von Teenagern gehört wurde (mein Eindruck, statistische Daten liegen mir dazu nicht vor … 😉).
Entwicklung der Band
Man könnte mutmaßen, dass sich darin die Entwicklung der Ärzte spiegelt: von purer Albernheit und lustvoller Niveauunterschreitung („Ich liebe ein Mädchen, die wäscht sich nie / Unterhalb und überm Knie“) hin (auch) zu ernsteren Themen wie Neofaschismus und gelegentlichen moralischen Appellen („Wie wär’s mit wählen gehen?“). Vielleicht ist es aber auch schlicht so, dass viele ihrer Anhänger der Band über Jahrzehnte treu geblieben, doch unweigerlich älter geworden sind, während „BelaFarinRod“ – wie man in Fankreisen sagt - zugleich noch immer ein junges und sehr junges Publikum anzieht. Und offenbar ist die Ärzte-Begeisterung mittlerweile bereits ins Erbgut mancher Familien eingedrungen. - Wer hätte das vor 36 Jahren gedacht?
Quellennachweis: Liedtexte zitiert nach https://www.bademeister.com/songs sowie https://www.farin-urlaub.de/songs/gluecklich und https://www.lyrics.com/sublyric/97486/Die+%C3%84rzte/E.V.J.M.F.