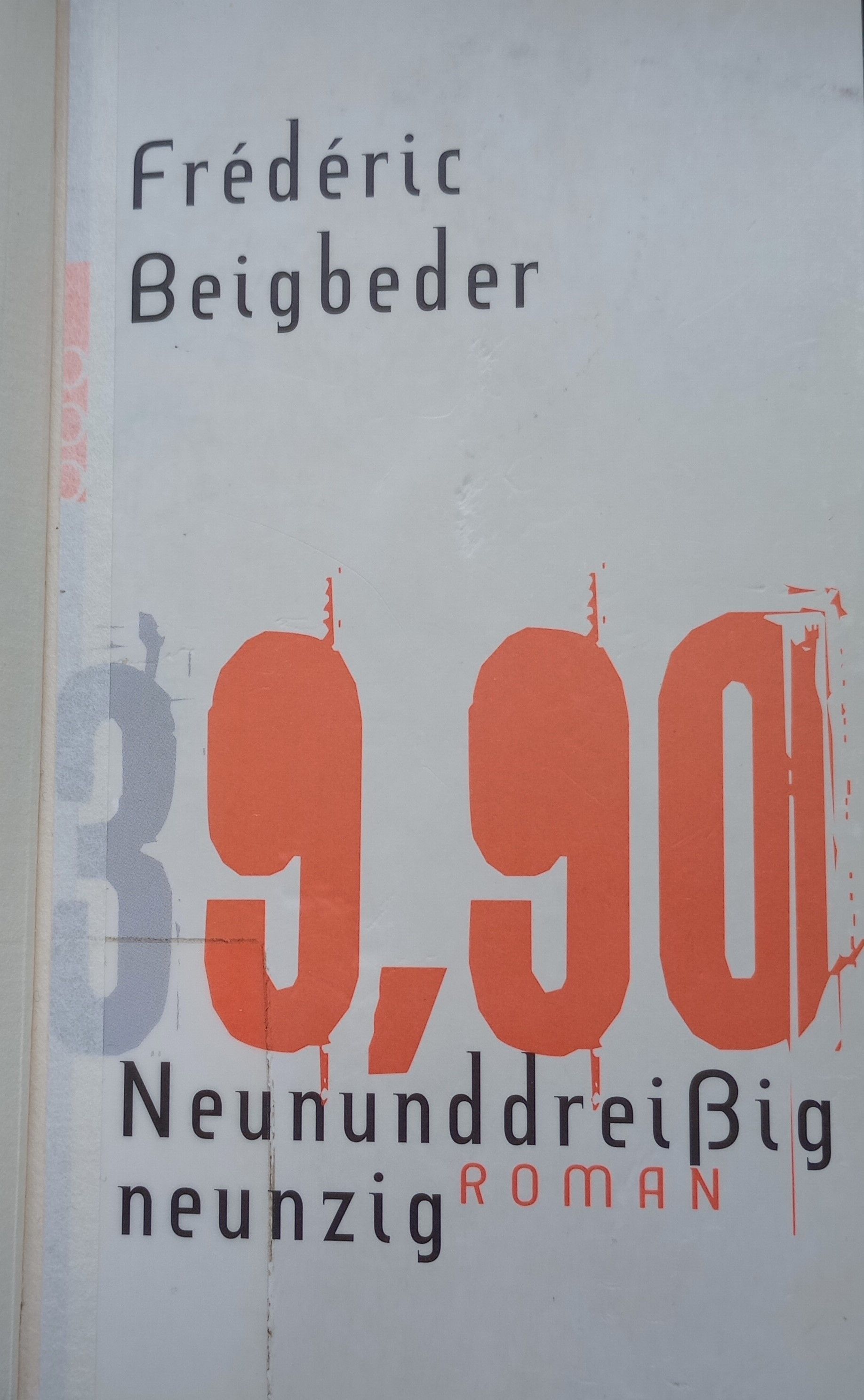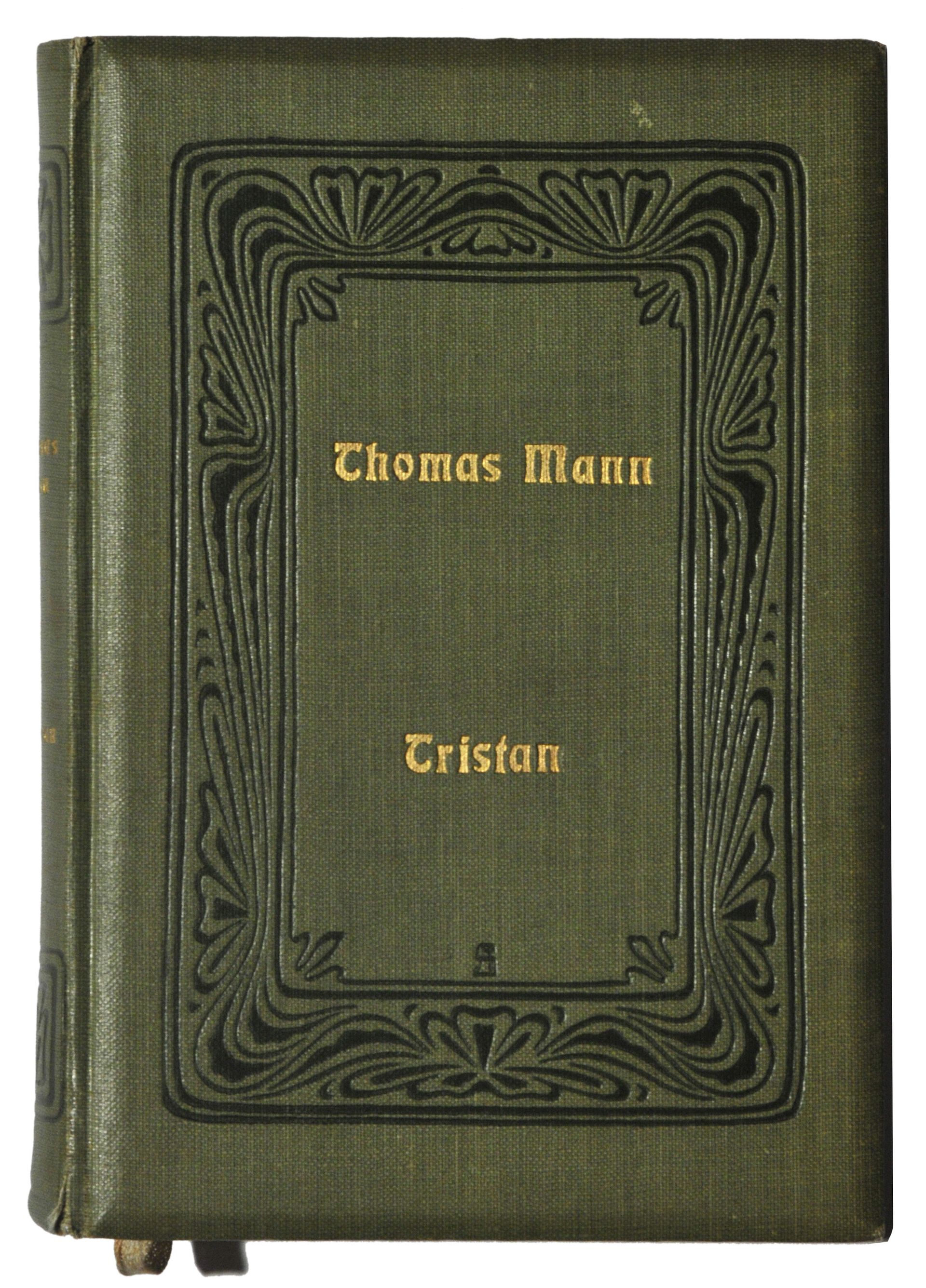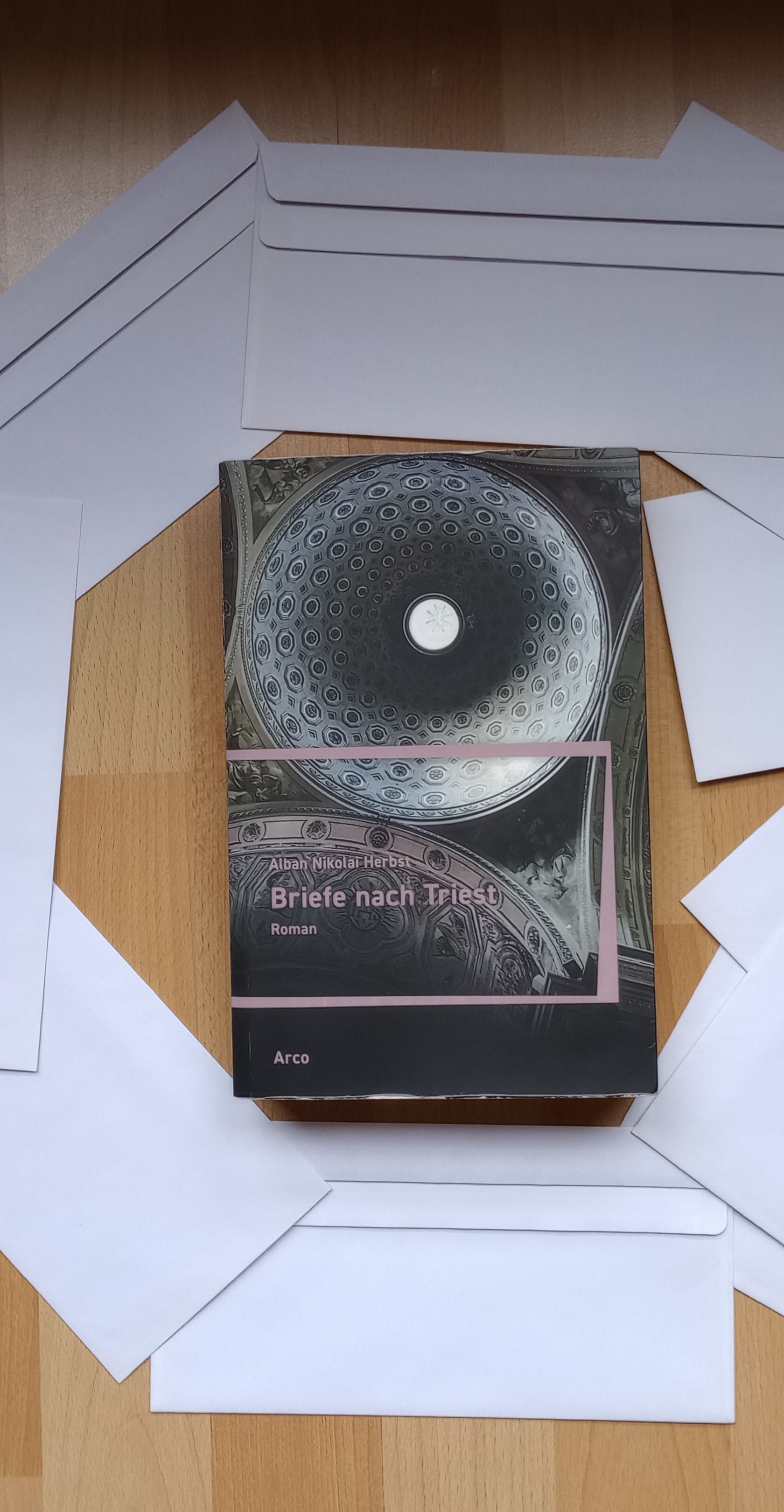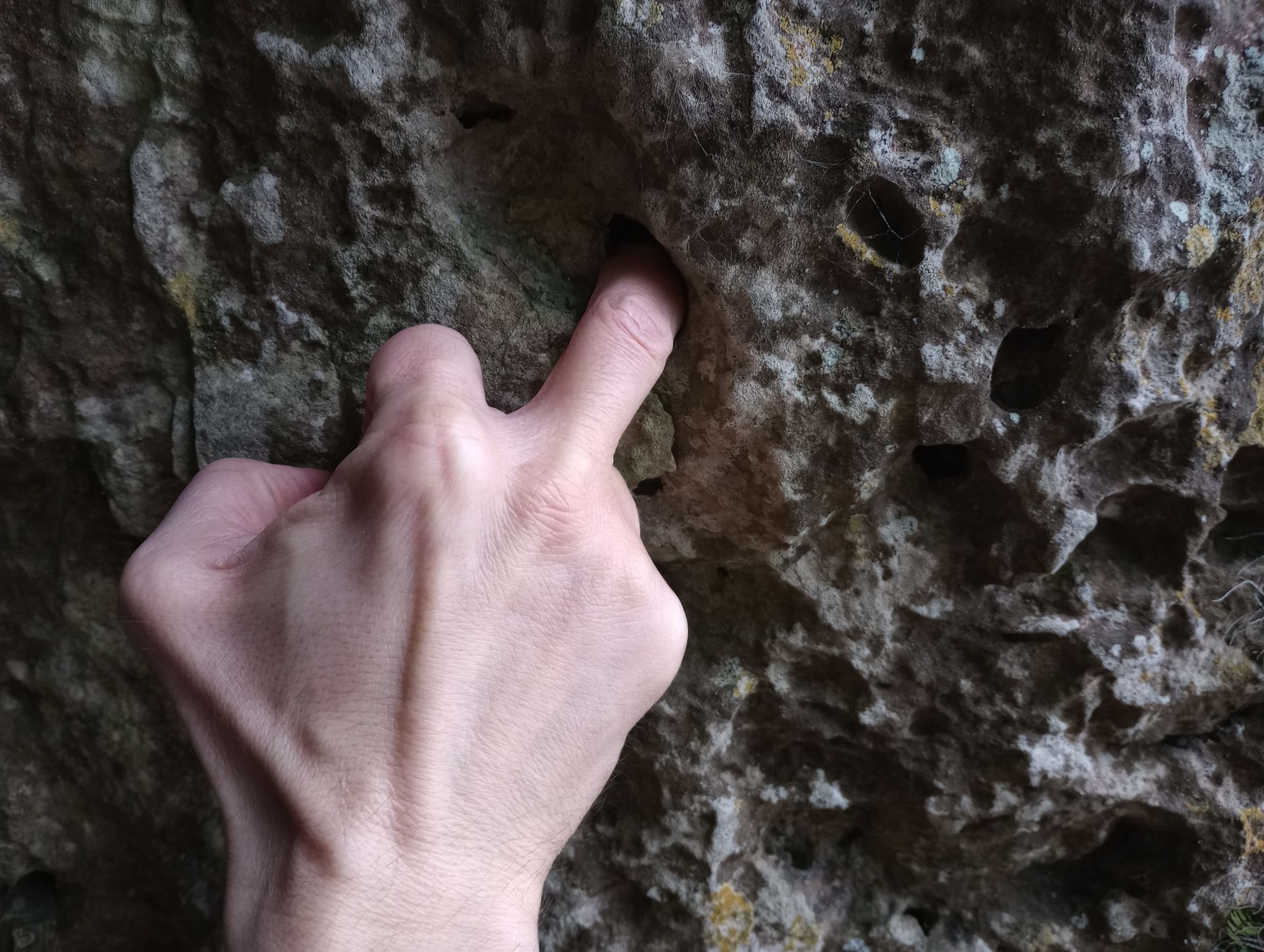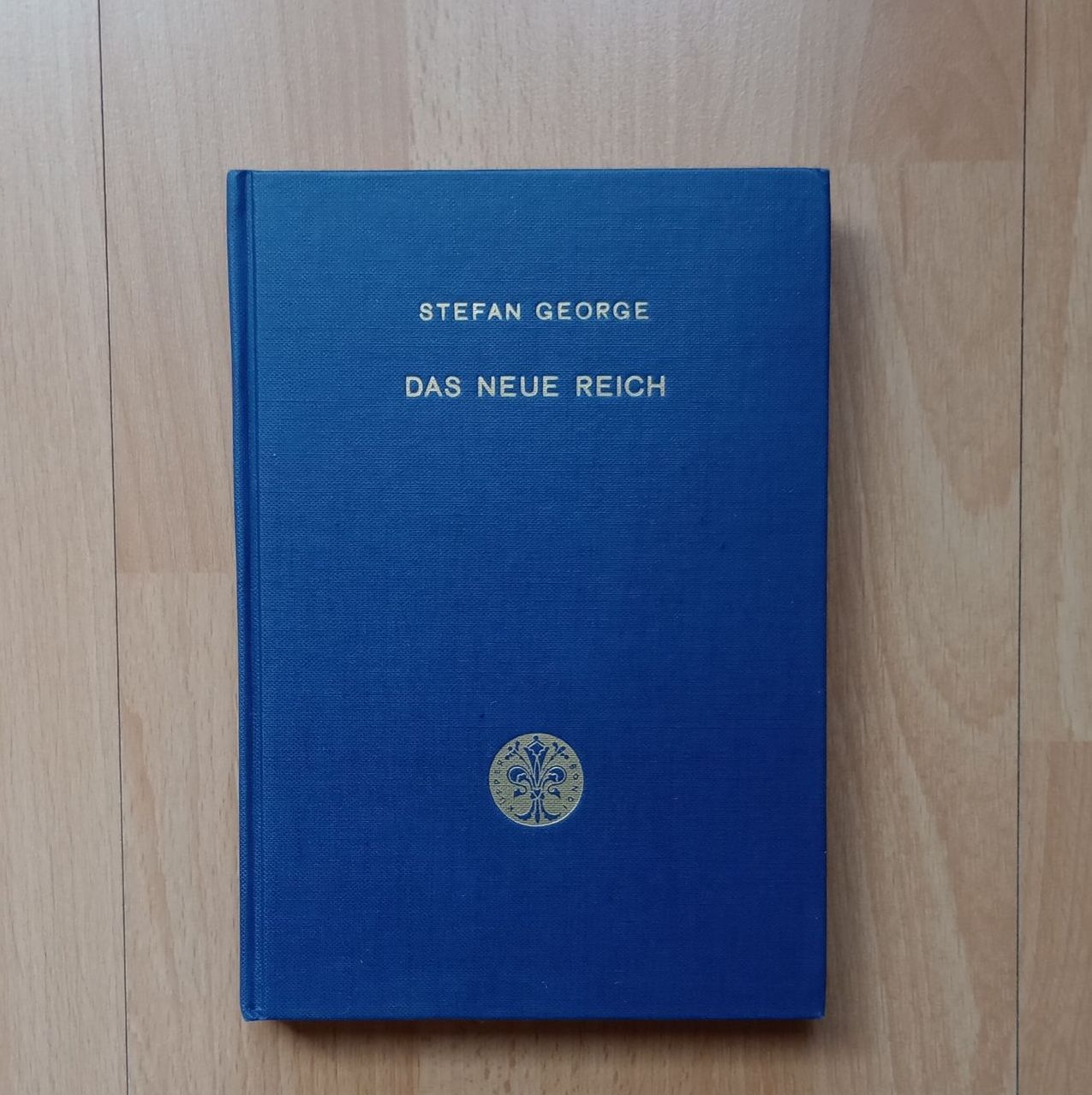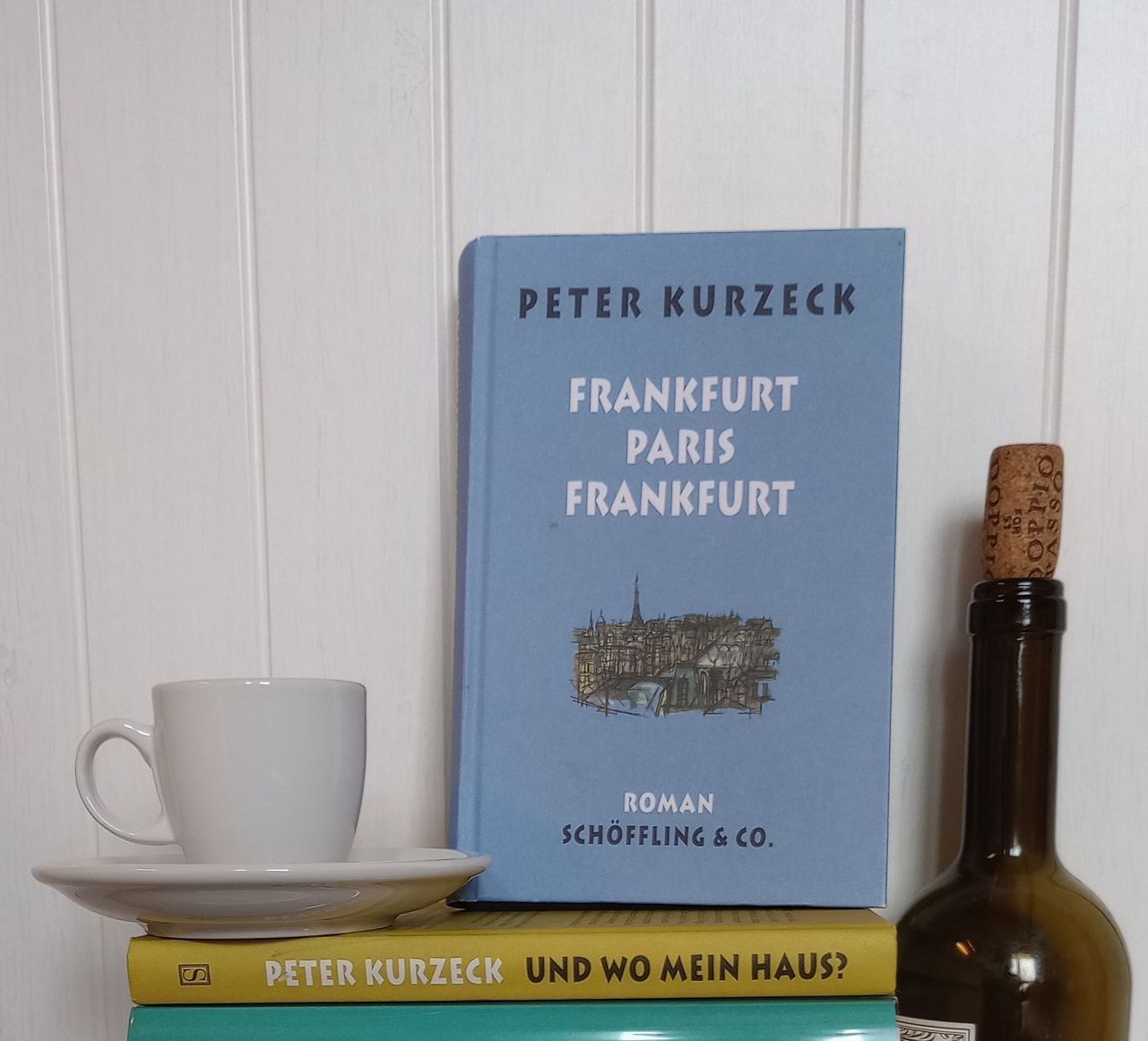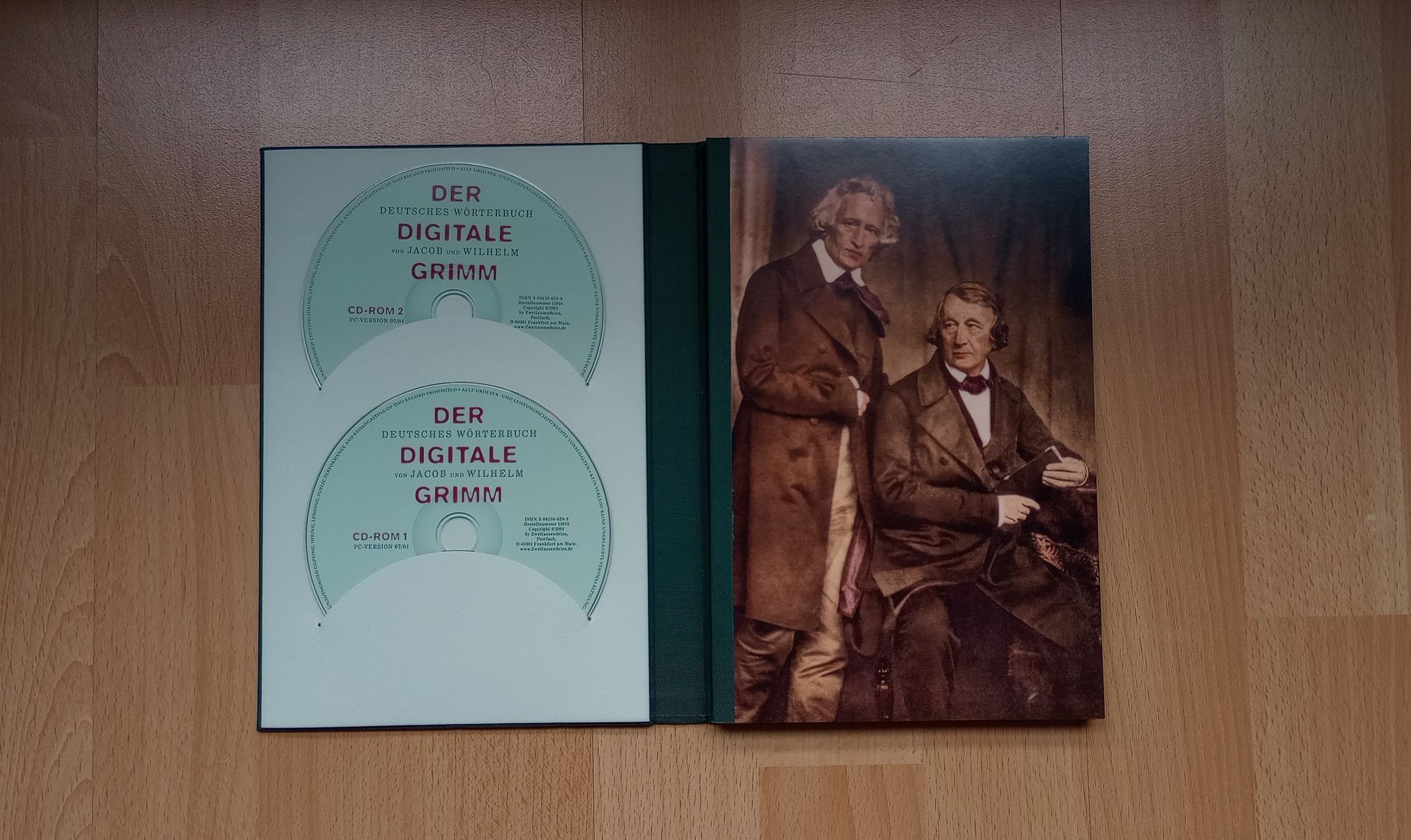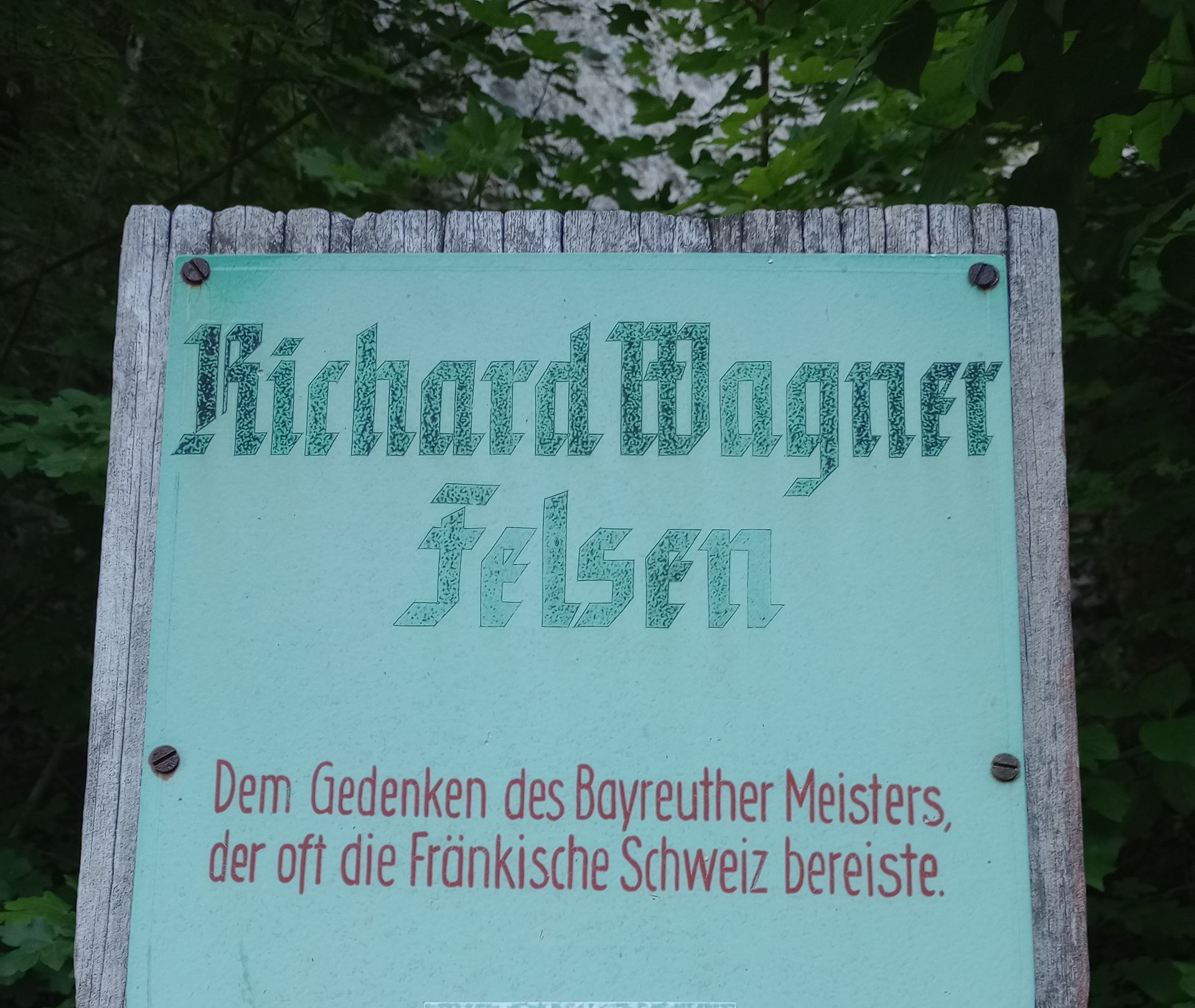von Arno Dahmer
•
23. Juni 2025
Es mag verwundern, dass ich einen Beitrag zu „Papyrus“ poste, denn das Marketing des Anbieters zielt vor allem auf Genre-Autoren bzw. Selfpublisher. Ich bin weder das eine noch das andere, nutze „Papyrus“ aber dennoch. Nachdem ich mehr als zwei Jahrzehnte in Word-Dokumente geschaut hatte, wollte ich 2023 mal etwas anderes sehen: So kam es, dass ich mir eine Papyrus-Lizenz besorgte. Papyrus ist eine wordähnliche Textverarbeitungssoftware mit zahlreichen speziellen Funktionen für Schriftsteller, insbesondere die Romanautoren unter ihnen. Da sich manch einer sicher fragt: „Braucht man denn so was?“, möchte ich hier eine Liste von Vor- und Nachteilen präsentieren, die aus meinen persönlichen Erfahrungen mit diesem Programm resultiert. – Hinweis: Ich nutze Version 11; seit kurzem ist Version 12 auf dem Markt, in der aber nichts Grundlegendes geändert wurde – so wenigstens mein Eindruck nach einigen Internetrecherchen. Vorteile Eine der für mich nützlichsten Funktionen ist der Navigator : eine Art erweiterbares Inhaltsverzeichnis. Zum einen können im Text Abschnitte definiert werden, die dann hier erscheinen: neben Kapiteln auch Szenen und „Ereignisse“ (weil meine Texte nicht nur aus Szenen und Ereignissen in solchen bestehen, arbeite ich damit nach dem Muster „Kategorie – Unterkategorie 1 – Unterkategorie 2“). Zum anderen lässt sich das „Inhaltsverzeichnis“ mit Notizen, Links, diversen Icons sowie bestimmten Informationen aus dem Text anreichern – z. B. blende ich im Navigator gern den Seitenumfang der Kapitel ein. Die sogenannte Normseite (30 Zeilen mit je 60 Anschlägen, Schriftart traditionell „Courier New“) ist ja eine wichtige Maßeinheit im Literaturbetrieb. Einreichungen zu Wettbewerben oder bei Verlagen sollen oft eine Mindest- oder Höchstzahl von Normseiten haben. Ich kenne allerdings niemanden, der seine Texte von vorneherein in diesem an die Schreibmaschinen-Zeit erinnernden Format verfasst. Praktisch ist daher ein Automatismus, der es dem Papyrus-Nutzer erlaubt, beliebig formatierten Text per Mausklick in Normseiten zu verwandeln . Eine Normseite einzurichten ist natürlich auch in anderen vergleichbaren Programmen kein Hexenwerk, etwa mithilfe einer Vorlage. Aber diese Lösung ist schon sehr komfortabel. Wie in Word können Dokumente mit Kommentaren versehen werden. In Papyrus gibt es zudem sogenannte Notizzettel , die eine ähnliche Aufgabe erfüllen, jedoch keiner spezifischen Textstelle zugeordnet sind, sondern in dem standardmäßig hellgrauen Bereich rechts bzw. links der eigentlichen Seite platziert werden, den man auch z. B. von Word kennt. Sie sind permanent sichtbar, solange man mit dem jeweiligen Dokument arbeitet, eignen sich also für Dinge, die Relevanz für den gesamten Text haben: Überlegungen zu einer Hauptfigur oder zum Handlungsaufbau; eine Information, die ihren Platz im Ganzen noch nicht gefunden hat u. Ä. Ein wenig lästig ist, dass sich die Abmessungen der Notizzettel nicht von allein an den zur Verfügung stehenden Platz jenseits der Seitenränder anpassen. Wenn man zoomt, kann es passieren, dass ein Notizzettel hinter die Seite rutscht bzw. zum Teil aus der Bildschirmansicht verschwindet. Die Größe muss dann händisch korrigiert werden. Wenn man mit den „ Zeitstempeln “ arbeitet, wird neben jedem Absatz angezeigt, wann er zuletzt bearbeitet wurde: eine hervorragende Funktion besonders für die Arbeit an langen Texten. Wermutstropfen: Sobald man in dem Absatz auch nur ein Leerzeichen löscht oder ein Komma einfügt, erhält dieser einen „Stempel“ mit dem aktuellen Datum und die ursprüngliche Zeitangabe geht verloren. Wird eine Passage als „ Geistertext “ markiert, bekommt sie eine andere Farbe und kann aus- bzw. wieder eingeblendet werden. Ich finde dies insofern hilfreich, als ich damit jederzeit eine lesbare Fassung des Manuskripts zur Hand habe. Die frühen Versionen eines Textes bestehen bei mir nämlich zu ungefähr 40 Prozent aus Varianten, „Regieanweisungen“, Hintergrundinformationen usw. – mit anderen Worten: einem Salat aus halbwegs Fertigem und allerlei anderem, was nicht für die Augen des Lesers bestimmt ist ... und auch, sozusagen, nicht für meine, wenn ich mir einen schnellen Überblick über das schon Geschriebene verschaffen will. Die Programmoberfläche ist in vielfältiger Weise anpassbar – das Ergebnis kann man als „ Arbeitsumgebung “ speichern. Dies ermöglicht den raschen Wechsel zwischen verschiedenen Modi. Ich nutze zwischendurch z. B. gern eine Arbeitsumgebung, in der die Bildschirmansicht im Wesentlichen auf den Text reduziert ist – einige wenige, für mich essentielle Funktionen indes verfügbar bleiben. Ein Backup-System lässt sich so einstellen, dass kontinuierlich Sicherungskopien erstellt, aber langfristig nur zum Teil aufbewahrt werden – gemäß vorab festgelegten Kriterien. Auf diese Weise hat man weder irgendwann hunderte von Backups auf der Festplatte noch besteht die Gefahr des Datenverlusts, weil man zu faul war, das Dokument periodisch unter neuem Namen zu speichern. (Es kommt ja vor, dass Dateien beschädigt werden und dann nicht mehr lesbar sind.) Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass automatisch immer eine größere Zahl älterer Versionen zur Verfügung steht und man gewissermaßen in der Zeit zurückspringen kann. Darüber hinaus bietet Papyrus viele weitere Funktionen, die für andere Autoren gewinnbringend sein mögen, von mir jedoch nicht oder kaum genutzt werden. Etwa gibt es diverse Möglichkeiten, eine Druckvorlage für Selfpublishing-Dienstleister wie „Amazon KDP“ zu erstellen. Es wäre noch zu sagen, dass die Software nicht allein für Schriftsteller geeignet ist. Vermutlich geht fast alles, was man mit Word machen kann, auch mit Papyrus. Nachteile Der Hauptnachteil ist mittlerweile leider der Preis . Dieser hat sich von Version 11 zu Version 12 fast verdoppelt und liegt jetzt bei 349 Euro. Immerhin bekommt man dafür eine Dauerlizenz und nicht eines dieser Abonnements, die fortlaufend Kosten verursachen. Unpraktisch ist die Suche . Im Gegensatz zu Word wird keine Trefferliste angezeigt. Sucht man in einem umfangreichen Dokument beispielsweise nach einem Namen, gleicht dies einem Blindflug: Man klickt sich von Treffer zu Treffer, weiß nicht, wie viele da noch kommen, und hat bei Fundstelle 6 womöglich schon vergessen, auf welcher Seite sich Fundstelle 1 befand. Gerade in einem Programm, das auf Großtexte ausgelegt ist, wäre eine Trefferliste Gold wert. Ein Manko ist auch die Darstellung der Leerzeichen . Diese werden wie in Word durch Punkte symbolisiert, die hier aber derart klein sind, dass man sie nur mit Mühe erkennt. Ein wenig entschärft wird das Problem dadurch, dass die Rechtschreibprüfung, sofern aktiviert, doppelte Leerzeichen ohnehin rot unterkringelt. Intuitiv bedienbar finde ich Papyrus nicht. Ich habe zirka ein Jahr gebraucht, um mich in dem Programm gut zurechtzufinden – und ich bin, denke ich, kein DAU (= „Dümmster anzunehmender User“). Ich würde daher von einer relativ langen Lernzeit sprechen. Um keinen falschen Eindruck zu erwecken: In Papyrus einen Text zu schreiben bzw. zu speichern oder zu drucken, ist nicht das Problem. Doch mit den Feinheiten muss man sich länger befassen. Allerdings hat dies mit Sicherheit auch damit zu tun, dass praktisch jeder heutzutage von den Microsoft-Programmen geprägt wurde: Man öffnet eine Textverarbeitung und wendet eine „Word-Logik“ an – was in Papyrus aber nur zum Teil hilfreich ist. Zwar sind viele Funktionen in beiden Programmen mehr oder weniger identisch, der Weg dorthin kann jedoch unterschiedlich sein. Hinzu kommen die speziellen Werkzeuge für Autoren, die ohnehin erst einmal Neuland sind, da sie in Word, OpenOffice u. Ä. schlicht nicht existieren. Das Design ist meiner Meinung nach sehr bunt und kindlich geraten. Natürlich ist das Geschmackssache. Fazit Papyrus bietet insbesondere Romanautoren eine Reihe interessanter Funktionen, auf die man ungern verzichten würde, wenn man sich einmal an sie gewöhnt hat. Ob einem diese Hilfsmittel mehrere hundert Euro wert sind, ist eine andere Frage.